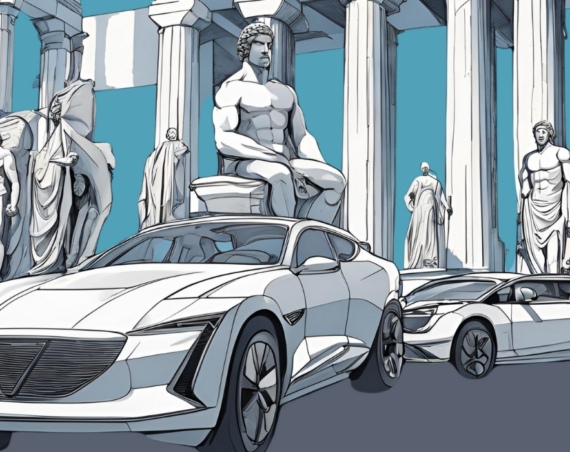Zuletzt aktualisiert am 24. Januar 2019
Wie kann man in derartig angelegten Untersuchungen Menschen mit intersexueller Identität abbilden, ohne zu diskriminieren oder den Datenschutz zu verletzen? – Einblicke in Vorträge der Tagung der Fachgesellschaften für Geschlechterforschung/-studien
Oft wird der Geschlechterforschung selbst der Vorwurf gemacht, heteronormative gesellschaftliche Standards zu reproduzieren. Sie verweise beständig auf geschlechtliche Dichotomien oder nutze diese unhinterfragt als „Mann-Frau-Variable“ in quantitativen Umfragen und Analysen, um auf bestehende Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten hinzuweisen. Wie kann man in derartig angelegten Untersuchungen Menschen mit intersexueller Identität abbilden, ohne zu diskriminieren oder den Datenschutz zu verletzen? Auf der Tagung der Fachgesellschaften für Geschlechterstudien „Aktuelle Herausforderungen der Geschlechterforschung“ von 28.-30.9.2017 an der Universität zu Köln, widmete sich ein Panel der Geschlechtsabfrage in quantitativen Forschungen. Unter der Ägide von Chairman Dirk Schulz gab es drei Vorträge, die vorwiegend aus der Praxis, also dem konkreten Umgang mit der Variable Geschlecht berichteten.
Zu 100 Prozent weiblich?
Den Anfang machte Elisabeth Kittel aus Wien, die von einer Paper-and-Pencil-Befragung aus der Soziologie berichtete, in der die Befragten sich auf einer Skala von 10-100 Prozente für ihre jeweilige gefühlte Geschlechtlichkeit geben konnten. Die Anteile mussten dabei nicht 100 Prozent entsprechen, sondern man konnte auch angeben, sich zu 80 Prozent weiblich und zu 80 Prozent männlich zu fühlen (was dann allerdings in der Auswertung auf jeweils 50 Prozent bereinigt wurde).
Über die Hälfte aller Befragten gaben an, sich nicht zu 100 Prozent einem Geschlecht zugehörig zu fühlen. Je jünger und gebildeter die befragte Person war, desto uneindeutiger fiel die Zuordnung aus. Männer gestanden sich dabei durchschnittlich maximal 20 Prozent Weiblichkeit zu, Frauen gingen im Gegensatz auch bis auf 50 Prozent runter. Frauen wünschten sich auch häufiger nicht zu 100 Prozent männliche Partner als umgekehrt.
Allerdings muss man beachten, dass diese Befragung in einem allgemeineren Rahmen stattfand, in dem es um eine Befragung zu der Vereinbarkeit von Haushalt und Beruf ging. Daher spielte der Wunsch nach einem Mann, der sich stärker im Haushalt beteiligt, wahrscheinlich eine beeinflussende Rolle.
„Mann“, „Frau“, „Sonstige“
Konkreter wurde es in dem sich anschließenden Vortrag von Michaela Müller aus Gießen, die für die empirische Sozialforschung den Vorschlag einer Nichtangabe von Geschlecht ablehnte. Die Nicht-Angabe von Geschlecht, die von einigen KollegInnen gefordert würde, würde die Realität nicht abbilden und Minderheiten das Recht auf Sichtbarwerdung und Partizipation verweigern. Allerdings wäre eine prozentuale Angabe von geschlechtlicher Identität oder auch ein offenes Feld derzeit nicht praktikabel. Bei einer derartig offenen Befragung von 500 Personen, gaben beispielsweise knapp 50 kein eindeutiges Geschlecht an, was eine Auswertung bzw. Nachkodierung schier unmöglich machte. Besser allerdings als ein drittes Feld „Sonstige“ neben „Mann“ und „Frau“ sei, so Müller, die Bezeichnung „Weitere“ da sie nicht den Beigeschmack eines seltsamen Sonderwegs trage. Das Problem eines unfreiwilligen „Outings“ bei der Befragung kleinerer Gruppen bliebe aber auch hier bestehen.
Erzwungene weibliche Schwäche im Hochleistungssport
Den Abschluss bildete ein Einblick in die zutiefst heteronorme Welt des Sports von der Sportwissenschaftlerin und Sportsoziologin Karolin Heckemeyer von der FH Nordwestschweiz. Mit teilweise verstörenden Berichten von Geschlechtertests in den 1960er-Jahren und noch heute erzwungenen Hormontherapien bei Sportlerinnen, kritisierte die Referentin die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Geschlechterdifferenzen und damit verbundener Hierarchien.
Sie sieht ihre Aufgabe als Sportsoziologin darin, hier andere Wege aufzuzeigen, Fragen nach der Chancengleichheit zu beantworten und antidiskriminierungspolitische Visionen des Sports in die Verbände einzubringen.
/Nina Kim Leonhardt